Die erste Generation der Menschenrechte bezeichnet ganz klare Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber Dritten (zu denen auch der Staat gehört), die willkürlichen Zwang ausüben wollen; dabei geht es um konkrete Dinge wie Eigentum oder Leben. Das „Recht auf Bildung“ aber ist ein Anspruchsrecht. Sollte es als Abwehrrecht verstanden werden, beispielsweise als Abwehrrecht gegenüber jemandem, der Bildung willkürlich vorenthält, dann schießt eine Schulpflicht hier weit über das Ziel hinaus. Da würde es beispielsweise ausreichen, schlicht mittels Bildungsgutscheinen aus dem Steuertopf das notwendige Schulgeld an eine private Bildungseinrichtung zu bezahlen (im Sinne einer zweckgebundenen Sozialhilfe, wie das ja schon bei Hartz4 geschieht).
Es gilt allerdings auch zu beachten, dass das „Recht auf Bildung“ in Konflikt mit dem Recht der Eltern auf Erziehung steht. Auch hier scheint mir eine Schulpflicht als Durchführung eines „Rechts auf Bildung“ zu radikal. Schließlich ist ein Recht etwas, das man in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. Wenn nun aber Eltern ihr Recht auf Erziehung nicht wahrnehmen dürfen, weil sie durch staatliche Regelungen zur Nichtwahrnehmung verpflichtet sind, dann ist das in meinen Augen widersinnig.
Homeschooling empfinde ich dabei übrigens nicht als Problem, denn die Erziehung des Kindes ist eben Sache der Eltern, und dadurch wird letztlich auch das Recht des Kindes auf Bildung umgesetzt. Sollte der Staat da überhaupt ein Recht haben, zu agieren, dann nur auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips, sprich: wenn die Eltern dies wünschen. Die Schulpflicht verhindert zwar eine „zu starke Indoktrination durch die Eltern“, sie ersetzt diese aber gleichermaßen durch eine absolute Indoktrination mit den Vorstellungen derjenigen Leute, die die Lehrpläne zusammenstellen. Nicht umsonst wurde die Schulpflicht überhaupt erst eingeführt, um die jüngeren Generationen zu staatstreuen Bürgern zu erziehen. Vorher wurde das Bildungssystem nämlich hauptsächlich von kirchlichen Einrichtungen getragen, und die haben den Schülern zumindest eine gesunde Skepsis gegenüber der Staatsmacht vermittelt. Das ist übrigens eine Kritikfähigkeit, die heute an kaum einer Schule gelehrt wird.
Der „skeptische Demokrat“ ist letztlich ein Phantom, ebenso wie der „mündige Bürger“, der immer wieder erwähnt wird, den aber noch niemand gesehen hat. Deshalb bedarf es eines Verbraucherschutzes oder gewisser Parteiverbote, damit der individuelle Skeptizismus nicht
zu arg strapaziert wird, weil man ihn benutzen muss. Und wenn in „halbwegs ausgewogenen Lehrplänen“ die Geschichte des modernen Staates als Siegeszug des Guten über die böse Kirchenmacht gefeiert wird, dann werden da eben keine „skeptischen Demokraten“ herangezogen, sondern linientreue Staatsbürger. Deutschland ist übrigens – neben der Slowakei – das einzige Land in Europa mit einer solch restriktiven Schulpflicht. In anderen Ländern besteht die grundsätzliche Möglichkeit, das Kind auch zu Hause zu unterrichten. Finnland hat z.B. eine Schul- aber keine Anwesenheitspflicht. Und in den Niederlanden kann man sogar als Privatperson problemlos seine eigene Schule gründen, die dann staatlich alimentiert wird.
An der Stelle einer Schulpflicht wäre es beispielsweise angebrachter, ein eigenes staatliches, sprich: steuerfinanziertes Bildungsangebot aufzustellen, das von jedem wahrgenommen werden kann, sofern er will – zwanglos. Dabei müsste es nach dem Verfassungsprinzip der Gleichberechtigung eigentlich nicht einmal ein staatliches Angebot für finanziell Schwächergestellte geben (also keine Bildungsgutscheine und kein steuerfinanziertes Bildungsangebot), sondern lediglich staatliche Sanktionen, sofern ein Bildungsanbieter einen Interessenten wegen des Geschlechtes, der Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft, des Glaubens, der religiösen oder politischen Anschauungen oder einer Behinderung ablehnt.
Das „Recht auf Bildung“ wird gemeinhin als ein Recht charakterisiert, das zur Wahrnehmung anderer (aller anderen?) Grundrechte befähigt. Das klingt so, als gäbe es ohne das Recht auf Bildung beispielsweise keine Abwehrrechte, weil sich niemand für das Recht auf Leben, Eigentum oder körperliche Unversehrtheit einsetzen könnte. Ich verstehe diese Art der Argumentation als Negierung einer natürlichen Veranlagung zu diesen Rechten, sprich: die Grundrechte stehen demnach dem Individuum nicht von Natur aus zu und beschränken die Macht des Staates, sondern sie existieren nur innerhalb des staatlichen Rahmens und werden von diesem gewährt. Unverblümt ausgedrückt also: Das „Recht auf Bildung“ garantiert in dieser Sichtweise, dass der Mensch zum Menschen wird; er ist dies also nicht von Geburt, sondern wird es erst durch die Wahrnehmung des „Rechts auf Bildung“. Das ist ein Menschen- und Staatsverständnis, das ich nicht teile, ja sogar für gefährlich halte.
Aus all dem ergeben sich für mich folgende Fragen:
- Welche Bildung genau ist im „Recht auf Bildung“ verankert?
- Wo genau kann ich dieses Menschenrecht verbindlich einklagen?
- Warum sollte die Wahrnehmung eines Anspruchsrechtes verpflichtend sein? Oder anders: Wurde das „Recht auf Bildung“ in Deutschland nicht eher durch eine Pflicht zum Schulgang ersetzt? Kann man da also tatsächlich noch von einem „Recht auf Bildung“ sprechen?
- Wie passt es zusammen, dass die Schulpflicht anscheinend mündige Bürger hervorbringen soll, wenn der mündige Bürger doch eigentlich die Voraussetzung des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates darstellt?
- Und wenn die Schulpflicht mündige Bürger hervorbringen soll: Muss ein Bildungssystem, das so eine Schulpflicht für länger als eine Generation benötigt, nicht konsequenterweise als gescheitert gelten?
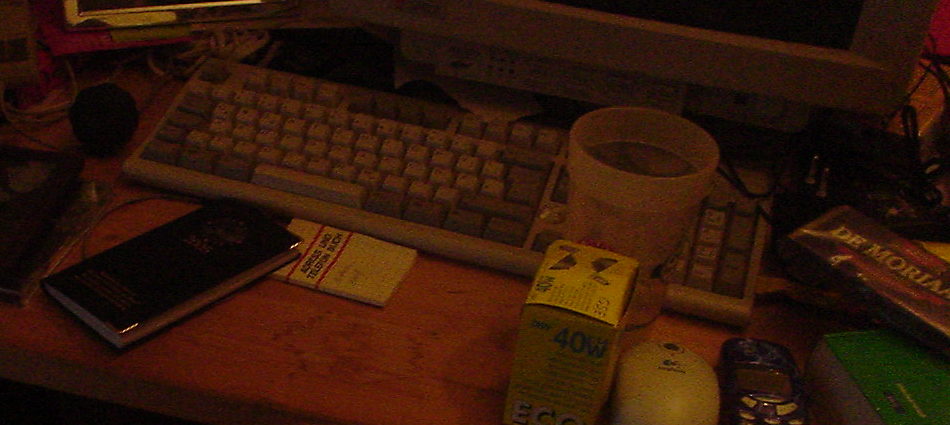
Schreibe den ersten Kommentar