Es läuft aktuell (wieder) eine Diskussion an, die sich um die Frage dreht, ob der Umgang mit der Alternative für Deutschland (AfD) „normalisiert“ werden sollte, inwieweit man sie also als Bestandteil des Parteiensystems der Bundesrepublik Deutschland an- und ernstzunehmen hat. Diese Diskussion läuft in verschiedenen Formen und Intensitäten eigentlich schon seit der Parteigründung im Jahr 2013. Was dabei an vielen Stellen allerdings untergeht, ist der Blick auf historische Erfahrungen jenseits einer obligatorischen Rhetorik, die den Bezug zur Weimarer Republik herstellt. Denn gerade im Umgang mit Parteien, die an „nationale“ oder „rechtsgerichtete“ Positionen andocken, gibt es auch historische Präzedenzfälle nach 1945, deren Vorbildcharakter für heutiges Handeln jeweils zu debattieren wäre.
Aus dem Erbe der alten Bundesrepublik lassen sich drei Modalitäten des Umgangs extrahieren:
Parteiverbot: die SRP
Gegründet 1949 als dezidierte Anlaufstelle und Sammelbecken für ehemalige Mitglieder der NSDAP sowie Vertriebene aus den (ehemaligen) deutschen Ostgebieten, stellte sich die Sozialistische Reichspartei (SRP) offen in die Tradition des Nationalsozialismus. Bis 1952 avancierte sie auf diese Weise zur größten bzw. wichtigsten Organisation des (west-)deutschen Rechtsextremismus, auch wenn der sog. „Adenauer-Erlass“ von 1950 öffentlich Bediensteten der Bundesrepublik eine Mitgliedschaft verbot. Inhaltlich positionierte sich die SRP offen antidemokratisch, außenpolitisch vertrat sie einen entschiedenen Antiamerikanismus und Neutralismus, wirtschaftspolitisch war sie um ein zwar sozialistisches, aber anti-marxistisches Profil bemüht. Antisemitismus und Holocaustleugnung gehörten ebenso zur Parteipraxis wie Bemühungen zur Verwendung einer christlich bzw. „christkonservativ“ klingenden Rhetorik. Die SRP hatte sich im parteipolitischen Gefüge der jungen Bundesrepublik bereits früh isoliert, und sie war im Jahre 1952 schließlich die erste Partei, die vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde.
Einbindung und Absorption: DP und BHE
In der frühen Bundesrepublik gründeten sich neben der SRP weitere Parteien rechts der Mitte: allen voran die Deutsche Partei (DP) und der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE). Die DP knüpfte direkt an die Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) an, welche bis 1933 bestand, und vertrat im Großen und Ganzen einen Nationalkonservatismus, der ehemalige Angehörige der Wehrmacht und Vertriebene ansprechen sollte. Insbesondere aber wollte die DP Wähler aus dem Bürgertum, die an der Schwelle zum Rechtsextremismus stehen, konstruktiv in den politischen Prozess der Bundesrepublik einbinden. Der BHE wiederum war eine Klientelpartei, und seine Zielgruppe waren die Vertriebenen; der BHE war gewissermaßen die „Flüchtlingspartei“ der jungen Bundesrepublik, und auf Länderebene ging er Koalitionen sowohl mit der CDU als auch mit der SPD ein. Adenauer band sowohl die DP (1949-1960) als auch den BHE (1953-1957) in die Bundesregierung ein. Durch die so vollzogene Aufnahme und Annahme der konstruktiv vorgebrachten Anliegen dieser Parteien entstand letztlich ein Sog-Effekt hin zur politischen Mitte in der Union, der wiederum zu einem Bedeutungsverlust und zu schwindenden Wahlerfolgen dieser Parteien führe: 1957 schaffte es der BHE nicht mehr in den Bundestag, und die DP erreichte den Wiedereinzug nur noch per „Huckepack“-Verfahren. Der Relevanzverlust beider Parteien führte sogar dazu, dass die Parteifusion aus DP und BHE (die Gesamtdeutsche Partei) schnell in die Bedeutungslosigkeit versank.
Marginalisierung und Abdrängung: die NPD
Die Gründung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) fand im November 1964 statt, und sie unternahm zunächst im Wesentlichen den Versuch einer Anknüpfung an die nationalkonservativen Traditionen rund um die Weimarer DNVP. Das initial erfolgreiche Moment der NPD in der Bundesrepublik war durch drei Faktoren bedingt: Zunächst gab es eine Art politisches „Vakuum“ nach (a) der Absorption von DP und BHE in die Union sowie (b) durch den zunehmenden Bedeutungsverlust des nationalliberalen Flügels in der FDP, der schließlich im Laufe der ersten Großen Koalition 1966-1969 zur Ausrichtung der FDP auf eine sozialliberale Koalition führte. Schließlich half der NPD jedoch auch (c) die Polarisierung und Extremisierung des öffentlichen Diskurses durch die sog. „Außerparlamentarische Opposition“ (APO), die nicht nur innerhalb der politischen Institutionen gegen vorherrschende Machtverhältnisse kämpfte, sondern die Institutionen als solche attackierte. Nach einigen Wahlerfolgen bei überregionalen Wahlen (das beste Ergebnis waren 9,8% bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 1968) verpasste die NPD den Einzug in den Bundestag 1969 jedoch knapp. Im Zuge der Stabilisierung des „Dreiparteiensystems“ aus CDU/CSU, SPD und FDP erfuhr die Partei schließlich einen Bedeutungsverlust (so erreichten die „Sonstigen“ bei der Bundestagswahl 1976 nicht einmal ein Prozent der Wählerstimmen). Nennenswerte „rechtsgerichtete“ Kräfte konnten sich erst wieder ab den 1980er Jahren hervortun, nachdem infolge des Einzugs der Grünen das bis dahin stabile Parteiensystem aufgebrochen wurde (Republikaner ab 1983, DVU ab 1987). Im wiedervereinigten Deutschland, in dem sich durch Hinzukommen der SED/PDS effektiv ein Fünfparteiensystem etablierte, konnten diese Kräfte schließlich wieder (vorübergehende) Wahlerfolge einfahren: Am erfolgreichsten waren in den 1990er Jahren die Republikaner, die zwischen 1992 und 2001 zweimal mit ca. 10% der Stimmen in den Landtag Baden-Württemberg einziehen konnten. Im Jahre 1998 kam die DVU mit einem Stimmenanteil von 12,9% in den Landtag von Sachsen-Anhalt. Zwischen 2004 und 2011 schließlich schaffte die NPD je zweimal den Einzug in die Landtage von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.
In der ehemaligen SBZ / DDR wurde indes ein anderer Umgang praktiziert:
Integration und Systembaustein: die NDPD
Im Jahr 1948 erfolgte in der Sowjetischen Besatzungszone die Gründung der National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD) unter maßgeblicher Beteiligung der Sozialistischen Einheitspartei (SED), auch und gerade um parteipolitische Konkurrenz zu Ost-CDU und Liberal-Demokratischer Partei (LDPD) zu schaffen. Ins Leben gerufen wurde die NDPD als gezieltes Angebot für Altnazis, mit besonderem Blick auf ehemalige Mitglieder der NSDAP, ehemalige Offiziere der Wehrmacht sowie Vertriebene, nachdem die Entnazifizierung in der SBZ durch Befehl der Sowjetischen Militäradministration als abgeschlossen proklamiert und damit gemäß der Anordnung Stalins die Trennung zwischen (Ex-)Nazis und Nichtnazis beseitigt worden war. Eingebunden in das „Bündnis aller Kräfte des Volkes“ (Art. 3 DDR-V 1968), stellte die National-Demokratische Partei im Rahmen der „Nationalen Front“ als Teil des „Demokratischen Blocks“ zwischen 1954 und 1986 mit 52 Abgeordneten in der Volkskammer ebensoviele Vertreter wie Ost-CDU, LDPD und Bauernpartei (DBD), und sie entsandte auch Vertreter in die Regierung. Programmatisch auf den Aufbau des Sozialismus verpflichtet, anerkannte die National-Demokratische Partei den Führungsanspruch der SED und lieferte im Herrschaftssystem der DDR eine dezidiert „nationale“ Perspektive, die zudem keine Berührungsängste gegenüber Verschwörungstheorien hatte.
Was also tun?
Der bisherige Umgang der etablierten Parteien mit der AfD führte die zunächst west-, dann gesamtdeutsche Praxis fort, „rechtsgerichtete“ Kräfte abzudrängen und zu marginalisieren. Was bei NPD, DVU und Republikanern mit den o.g. Ausnahmen im Großen und Ganzen, sowie bei Vereinigungen wie dem Bund Freier Bürger (BFB) in den 1990ern oder bei der Partei „Die Freiheit“ nach dem Jahrtausendwechsel noch funktioniert hat, ist im Falle der AfD jedoch offensichtlich gescheitert: Im Jahre 2013 noch knapp von der Sperrklausel gestoppt, zog die Partei 2017 erstmals in den Bundestag ein, und sie konnte von der Bundestagswahl 2021 zur Bundestagswahl 2025 ihr Ergebnis auf 20,8% verdoppeln. In vielen Wahlumfragen stellt sie mittlerweile die stärkste Kraft auf Bundesebene, in den neuen Bundesländern bisweilen gar die mit Abstand stärkste Kraft bei Landtagsumfragen.
Die ostdeutsche Praxis der Integration eines nationalen bzw. national-demokratischen Angebots als Systemstütze erscheint indes inhärent problematisch: Im Gegensatz zur (alten) Bundesrepublik etablierte sich in der ehemaligen DDR keine zivilgesellschaftlich selbstverständliche Abgrenzung zu einem explizit nationalen bzw. national-demokratischen Angebot; tatsächlich gehörte es zum „guten Ton“ bzw. zur staatsbürgerlichen Verpflichtung, eine solche Partei zu wählen. Das kann erklären, warum sich NPD und DVU, die sich im wiedervereinigten Deutschland explizit als Option für „nationale Sozialisten“ aufgestellt und präsentiert haben, gerade in den neuen Bundesländern festsetzen und verankern konnten. Es kann ebenso erklären, warum der Speckgürtel der AfD mit der Rhetorik eines „solidarischen Patriotismus“ ähnliche Erfolge zeitigt. Diese Konsequenz der SED-Herrschaft mag mithin wohl ein Grund sein, warum sich die rechtsidentische Fortsetzung der SED heute für ein Verbot der AfD ausspricht (und es mag vielleicht auch dazu führen, dass die SED-Fortsetzung ein adäquates Verhältnis zur eigenen Vergangenheit entwickelt).
Ein Parteiverbot scheint im Kreise der etablierten Parteien heutzutage wenn nicht die größte, so doch die rhetorisch entschlossenste Unterstützung mit der größten Lautstärke zu genießen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sehr gute und vor allem juristisch wasserdichte Vorbereitung des Verfahrens. Ein erfolgreicher Präzedenzfall findet sich im o.g. Verbot der SRP; ein unglückliches Beispiel findet sich in den beiden Verbotsverfahren gegen die NPD: Das erste Verbotsverfahren war 2003 an Verfahrensfehlern gescheitert, auch und gerade in Bezug auf die Rolle von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes; das zweite Verbotsverfahren scheiterte an der damals nicht mehr gegebenen Relevanz bzw. dem unzureichenden Potenzial der Partei. Das Potenzial der AfD scheint nun sehr viel höher als das der früheren NPD; das könnte jedoch dazu führen, dass die AfD als Folge eines gescheiterten Verfahrens noch mehr Zulauf erfährt. Hinzu kommt eine theoretische Erwägung, die sich gleichsam empirisch unterfüttern lässt: Ein Parteiverbot beseitigt nicht das darunterliegende Gedankengut. Auch nach dem Verbot der SRP gab es in (West-)Deutschland noch Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie, Judenfeinde und Antiamerikaner. Selbst in Bezug auf die AfD lässt sich etwas Analoges beobachten: Obwohl die parteiinterne Gruppierung „Der Flügel“ formell aufgelöst wurde, existieren entsprechende Netzwerke und Überzeugungen weiterhin.
Die Einbindung und Absorption in westdeutscher Tradition hat im wiedervereinigten Deutschland hingegen bereits geklappt: Nachdem die sog. „Schill-Partei“ (eigentlich: Partei Rechtsstaatlicher Offensive / PRO) bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2001 ~19% der Wählerstimmen erreicht und als drittstärkste Fraktion mit CDU und FDP eine Regierungskoalition gebildet hatte, konnte der Regierende Bürgermeister Ole von Beust als Resultat der „Affäre Schill“ bei der darauffolgenden Bürgerschaftswahl die ehemaligen „Schill“-Wähler an sich binden und so die absolute Mehrheit der Stimmen gewinnen. Natürlich gibt es in diesem konkreten Sachverhalt Besonderheiten, die sich nicht verallgemeinern lassen. Doch grundsätzlich lässt sich die Option der Einbindung und Absorption in zwei Aspekte zergliedern: zum einen steht die aktive Zusammenarbeit im Rahmen einer Koalition (wie mit der DP 1949 sowie mit der „Schill“-Partei 2001 geschehen); zum anderen die Einbindung als Teil einer Mehrheit im Rahmen einer „übergroßen“ Koalition (wie 1953 mit dem BHE, sowie 1953 und 1957 mit der DP geschehen). Der Unterschied zwischen beiden Aspekten liegt darin, dass die eingebundene politische Kraft im Rahmen einer („kleinen“) Koalition einen notwendigen Bestandteil für die Mehrheit darstellt; im Rahmen einer „übergroßen“ Koalition ist die so eingebundene politische Kraft kein notwendiger Bestandteil der Mehrheit. Letzteres ließe sich mit Abstrichen analog auf den Modus einer Minderheitsregierung anwenden, demnach sich die Einbindung im Rahmen eines situativen „Mehrheitsbeschaffers“ vollzieht. Das wiederum öffnet die Möglichkeit, die Einbindung mit einer inhaltlichen Konfrontation zu verbinden: Wo die Koalitionsdisziplin bei „kleinen“ und „übergroßen“ Koalitionen allzu scharfe Auseinandersetzungen deckeln mag, da besteht so eine Einschränkung im Rahmen einer Minderheitsregierung, die sich ihre Mehrheiten dauerhaft erstreiten muss, nicht. Damit dies gelingen kann, bedarf es allerdings zweier notwendiger Voraussetzungen: Zum einen müssen die Parteien in sich, an sich und für sich (nach innen) einen klaren Kurs definieren und umsetzen; dazu gehört neben einem klaren Selbstverständnis der Partei als Ganzes auch eine ausgeprägte Führungsstärke der handelnden Akteure. Zum anderen brauchen die Parteien untereinander einen klaren Konsens; dazu gehört auch, dass die demokratischen Parteien der Mitte die Minderheitsregierung tatkräftig gegen „rechtsaußen“ stützen und unterstützen (und sich, beispielsweise, nicht über verfehlte Mehrheiten des Regierungschefs freuen).
Welche dieser Möglichkeiten die größten Erfolgsaussichten bieten kann und darum zu bevorzugen wäre, hängt nun zum einen von der AfD selbst ab: Ihr Erfolg liegt nicht zuletzt daran, dass sie es geschafft hat, als eine Art Sammlungspartei neben Protestwählern ein breites Spektrum von nationalliberalen über nationalkonservative bis hin zu völkischen und gesichert rechtsextremistischen Kräften an sich zu binden. Das böte eigentlich für jede der vorgenannten Möglichkeiten einen Ansatzpunkt, und es käme am Ende vielleicht auch darauf an, welches der Elemente sich auf Dauer innerhalb der AfD durchsetzen kann. Die Parteigeschichte, in deren Verlauf sich die dominierende Strömung vom Nationalliberalismus über den Nationalkonservatismus und den Rechtskonservatismus zu einer völkischen Ausrichtung gewandelt hat, mag dazu wesentliche Einsichten liefern.
Die Grundsatzfrage für die gesamte Diskussion muss, auf der anderen Seite, allerdings lauten: Welche „Norm“ ist in dieser Frage entscheidend für eine „Normalisierung“? Wenn nämlich die Bewertung der Verknüpfung von Mensch-Sein und Menschen-Würde als „Fehlschluss“ dafür qualifizieren kann, eine „gemäßigte Position“ aus der „Mitte der Gesellschaft“ zu vertreten (oder dieser Einordnung zumindest nicht entgegensteht), dann wäre genau das die vorrangig notwendige Diskussion in politischer wie gesamtgesellschaftlicher Hinsicht.
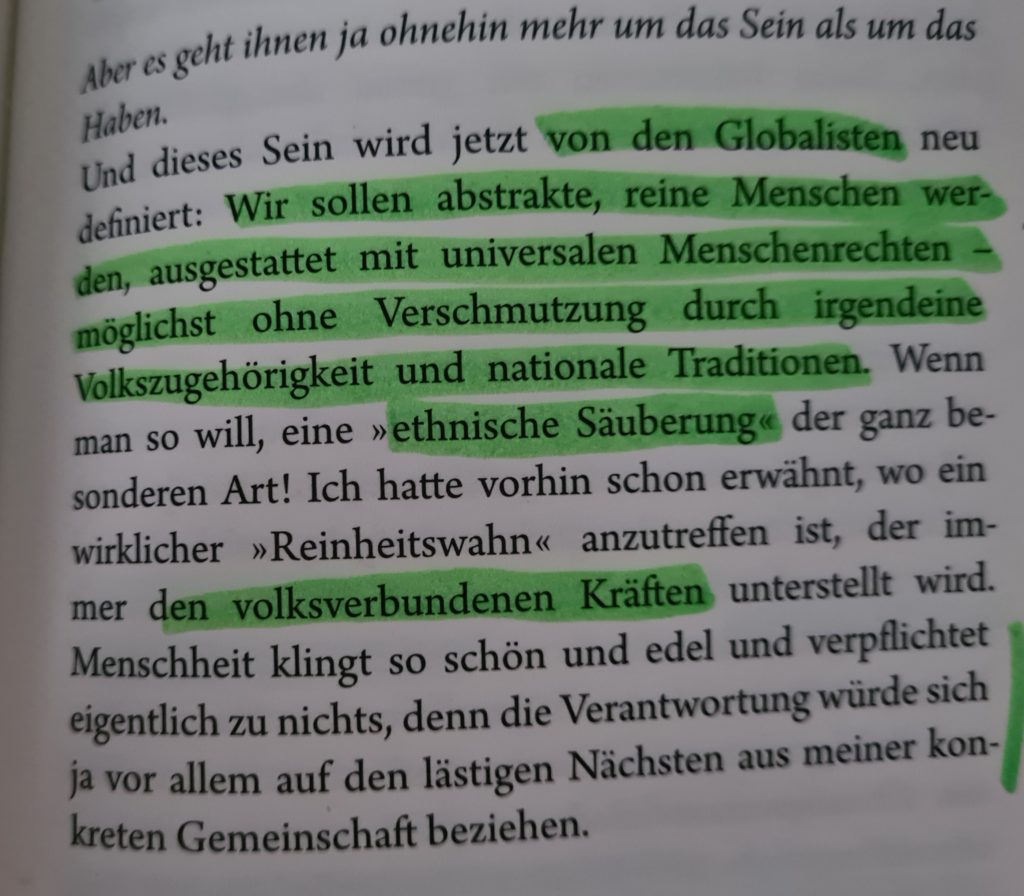

Schreibe den ersten Kommentar