Die Abschaffung des Bildungsföderalismus in Deutschland halte ich für absolut falsch. Die Folge einer solchen noch weiter vorangetriebenen Bildungskollektivierung (ich habe hier bewusst die Worte „Harmonisierung“ oder „Gleichschaltung“ vermieden, weil das nur wieder eine Diskussion über die bloßen Begrifflichkeiten nach sich zöge) wäre eben nicht, dass nirgendwo mehr Studiengebühren bezahlt werden müssten, sondern, dass diese überall an bereits steuerfinanzierten Einrichtungen eingeführt würden. Wo sich jetzt der finanzschwache Kurpfälzer oder Hesse noch über den Rhein retten kann, wird das eben nicht mehr gegeben sein. Eine weitere Folge wäre auch, dass es flächendeckend kein höheres, sondern ein niedrigeres Bildungsniveau gäbe. Nicht Bremen würde Bayerns Anforderungen übernehmen müssen, sondern umgekehrt – man muss ja gerade auf die Schwachen zugehen, wie es gerade in diesem Zusammenhang immer wieder heißt. Wo sich heute der Südhesse für ein anspruchsvolleres Abitur noch nach Baden-Württemberg retten kann (oder der Ulmer nach Neu-Ulm), da entfällt diese Option. Alle würden natürlich schön gleich gemacht – allerdings gleich „dumm“.
Und weil dann natürlich alle deutschen Schulabgänger auf so einem niedrigeren Gesamtniveau stünden, würde der Unterschied zu anderen Ländern noch schmerzhafter aus- und auffallen. Ruckzuck würde der Ruf laut werden nach einer weiteren Stufe der Kollektivierung: Warum keine Kollektivierung nach sprachlichen Grenzen? Es ist doch unfair, dass der deutschsprachige Schüler aus Basel besser gebildet ist und es damit leichter hat als der deutschsprachige Schüler aus Konstanz – obwohl beide an der Uni in Freiburg studieren. Oder weiter gedacht: Warum nicht gleich EU-weit kollektivieren? Es ist doch reichlich unfair, wenn der Franzose und der Finne zwar die gleichen Kurse an der Uni in Sussex besuchen, letzterer aber durch seine Schulbildung sehr viel besser abschneidet. In Anbetracht der Tatsache, dass beide aus EU-Staaten kommen, ist das doch ein Skandal: Bildung sollte schließlich nicht vom Säckel der eigenen nationalen Regierung abhängen, sondern ohne Schranken gewährt werden. Konsequent weitergedacht kann man das bis zur globalen Einheitsbildung fortführen. Ob das das Ziel sein kann? Da halte ich es immernoch mit der klassisch-liberalen Ansicht, dass Monopole ein verdammt mieses Preis-Leistungsverhältnis entwickeln. Die Antwort darauf kann aber nicht noch mehr Monopolisierung lauten.
Um eine beliebte Floskel aufzugreifen: Bildung ist Menschenrecht. Und genau deshalb darf
sie nicht verstaatlicht werden.
Den vernünftigen Mittelweg, eine ordentliche Schulreform durchzuführen, sehe ich darin, diese Reform an den Schulen selbst anzusetzen. Nur dort kann man wissen, wie man am besten auf die eingeschriebenen Schüler zugehen und ihnen die Inhalte vermitteln kann. Am sinnvollsten organisiert ist es also auf genau dieser Ebene, da hier noch wirklicher Kontakt zu denjenigen Menschen, für die eine Reform gemacht wird, besteht, und nicht irgendwo in der Ferne ein Sesselschieber darüber entscheidet. Die Auswirkungen einer Reform lassen sich wiederum direkt beobachten und auswerten, eine schnelle Reaktion ist unmittelbar möglich. Sprich: Diese Ebene ist am nächsten zu den anfallenden Problemen und kennt sich dadurch also am besten damit aus.
Das am häufigsten genannte Problem – namentlich, dass bei einer Entstaatlichung der Bildung der finanzielle Status der Eltern zum Maßstab für die Bildung der Kinder würde – ließe sich durch Stiftungen oder Stipendien lösen. Ein Unternehmen beispielsweise, so es denn als Schulträger agiert, wäre ja durchaus daran interessiert, dass die größtmögliche Anzahl an schlauen Köpfen die eigenen Bildungsangebote nützt oder nutzen kann, da so eine größtmögliche Anzahl an fähigen Mitarbeitern entstünde. Und da ist es gar nicht so abwegig, dass man gegen entsprechende (Schul-)Leistung auch Vergünstigungen in Sachen Schulgeld bekommt. Sprich: dass es eben gerade nicht von der Geld-Leistung der Eltern abhängt, sondern von der Eigen-Leistung des jeweiligen Schülers. Ein solches Stipendium könnte dann natürlich auch für die Kinder von Transferempfängern gelten. So etwas würde gleichzeitig das soziale Prestige des jeweiligen Stiftungsträgers erhöhen. Sollte eine Religionsgemeinschaft der Schulträger sein, so wäre auch ein entsprechend aus der beispielsweise katholischen Soziallehre hergeleitetes Angebot für finanzschwache Familien denkbar. Oder generell eine private Initiative – ein Hilfsverein menschenfreundlicher Atheisten oder ein Förderverein humanistisch eingestellter Schöngeister beispielsweise – an der sich die Mitglieder finanziell beteiligen, um so den finanziell Benachteiligten ein vergünstigtes Bildungsangebot zur Verfügung zu stellen. Alternativ wäre es in meinen Augen aber auch durchaus denkbar, dass der Staat hier ein eigenes Bildungsangebot ins Leben ruft, das ganz ähnlich funktioniert. Wer sich daran beteiligen und unterprivilegierten Kindern die Schule finanzieren möchte, könnte dann auf der Lohnsteuererklärung ein Kreuz in ein entsprechendes Kästchen setzen und infolgedessen zusätzlich einen Teil seines Lohnes in einen Fördertopf werfen, der genau das finanziert.
Die Nachfragebefriedigung nach besserer Bildung wird übrigens heute schon privat gelöst – trotz des staatlichen Schulmonopols. Viele Eltern schicken ihre Kinder zur Nachhilfe, weil die staatliche Schule nicht einmal ihre eigenen Bildungsstandards vermittelt (und, ja, das liegt an wirtschaftlichen Gründen). Warum sollte sich das, bei einem Wegfall des staatlichen Schulmonopols, ändern?
Was in Deutschland aktuell unter „Privatschule“ firmiert, kann hingegen nur sehr schwer als solches bezeichnet werden. Der Staat finanziert hier – nein, anders: die Nettosteuerzahler finanzieren hier einen ganz gehörigen Teil mit, selbst wenn weder sie noch ihre Kinder jemals dieses Bildungsangebot nutzen können oder dürfen. Der Staat – nein, anders: die Kultusministerien der Länder bestimmen, was dann in diesen Bildungseinrichtungen gelehrt werden muss. „Privatschulen“ sind darum bestenfalls halbstaatliche Schulen. Und weil das Schulgeld zusätzlich zur Steuerfinanzierung bezahlt wird, können sich das eben nicht alle leisten, sondern nur diejenigen, die finanziell bessergestellt sind.
An dieser Stelle sollte ich aber wohl erwähnen: Privatisierung des Bildungswesens bedeutet nicht „Verkonzernisierung“ des Bildungswesens. Das staatliche Schulmonopol soll nicht verlagert oder übertragen, sondern gänzlich aufgebrochen und abgeschafft werden. Sprich: Der heute bestehende Zwang, bestimmte von Regierungsseite aus genehmigte Bildungseinrichtungen mit dem eigenen Geld zu finanzieren, soll wegfallen. Wem die Leute dann im Einzelnen ihr Geld für Bildung geben, wie sie dahingehend also investieren wollen, bleibt jedem, der Geld verdient und/oder Geld hat, selbst überlassen. Privatisierung bedeutet übrigens ebenso nicht „Ver-Stiftungisierung“, wenn man mir diese Wortkreation nachsieht. Stiftungen sind eine Möglichkeit, sozial Schwächeren zu einer Bildung zu verhelfen (!), die sie sich nicht aus eigener Kraft leisten können. Wer andere Ideen hat, kann diese gerne umsetzen – so lange sie eben nicht auf Zwang basieren. Es wird, zumindest wenn es nach mir ginge, nicht einmal ein staatliches, d.h. steuerfinanziertes, Bildungsangebot verboten, ganz im Gegenteil: Der Staat kann liebend gerne ein eigenes Angebot machen und sich dem Wettbewerb mit anderen Bildungsträgern stellen – so lange die finanzielle Beteiligung auf freiwilliger Basis geschieht (siehe oben, das Kreuz auf der Einkommenssteuererklärung). Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass niemand für etwas zu zahlen hat, für das er nicht zahlen will. Wer so großherzig ist und fleißig spenden will, obwohl er keine Kinder hat oder obwohl seine Kinder andere Bildungseinrichtungen nutzen, dem bleibt das unbenommen und der kann gut und gerne fleißig spenden. Ob er nun mittelbar oder unmittelbar, sofort oder später davon profitiert, ist dabei irrelevant. Und ich bin mir sicher, dass jeder, dem die sozial schwachen Kinder am Herzen liegen, eine entsprechende Spende entrichten oder einen Weg finden wird, den sozial schwachen Kindern zu helfen, ohne gleich alle anderen zu (s)einer Geisel des staatlichen Gewaltmonopols zu machen. Anders formuliert: Wer ein so großes Herz hat, dass ihm seine Mitmenschen tatsächlich an selbigem liegen, der kann wirkliche Solidarität praktizieren und diesen Leuten durch freiwilliges Geben helfen statt sein Gewissen mit einem Zwangssystem beruhigen zu müssen.
Bildungspolitik im eigentlichen Sinne kann nur in einem monopolisierten Bildungswesen existieren. Dieses Monopol soll nun aber gerade gebrochen werden. Insofern entfällt auch die Bildungspolitik, und die Zielvorgaben werden folgerichtig zwischen Lehrer/Lehranstalt, Eltern und Kind entwickelt. Die Vorteile liegen darin, dass – bei einer Bestimmung der Zielvorgaben im Dreieck aus Lehrer/Lehranstalt, Eltern und Kind – die Entscheidung über die Inhalte dort gefällt wird, wo sie hingehört, wo sie am besten entschieden werden kann, und wo individuell auf die Stärken und Schwächen des jeweiligen Schülers eingegangen werden kann. Das ist zumindest in meinen Augen einem aus der fernen Hauptstadt oktroyierten „Massen in Klassen“ vorzuziehen. Die Problemstellung beginnt schließlich bereits dort, wo zwei verschiedene Elternpaare zwei unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, was der Sprössling denn in der Schule lernen soll. Die einen wollen ihn mehr naturwissenschaftlich bilden lassen, bei den anderen sind Sprachen wichtiger, ein drittes Elternpaar (oder die alleinerziehende Krankenschwester, je nachdem) will dem Kind beides mitgeben, hält aber Latein für absolut unnütz. Das zieht sich bis zum sog. „Unschooling“, bei dem Eltern und Lehrer einfach warten, bis das Kind an etwas Interesse zeigt und von sich aus auf beide Instanzen zukommt. Bildungskonzepte gibt es sehr viele. Und da ich glaube, dass Eltern und Kind am besten wissen, welches Konzept am besten passt, sollte das nicht von einem Bürokraten oder gar vom Nachbarn mittels geheimer Abstimmung bestimmt werden.
Mein Problem ist, dass das heutige Bildungswesen auf einem Monopol gründet, das sich durch einen Zwang hält, der letztendlich auf der Androhung oder Durchführung von (staatlicher) Gewalt basiert. In meinen Augen kann ein System, dessen Grundlage Gewalt ist, keine Gewaltlosigkeit hervorbringen. Gewaltlosigkeit sehe ich aber als Voraussetzung, um dem Mitmenschen tatsächlich als Mensch auf Augenhöhe zu begegnen und ihn nicht zum Objekt der eigenen Gewaltausübung zu degradieren. Das ist der tiefere Nährboden, auf dem sich meine Ablehnung des staatlichen Bildungswesens bewegt: das Infragestellen des staatlichen Gewaltmonopols. Es mag sein, dass der eine oder andere mit Gewalt keine Probleme hat und es sogar ganz in Ordnung findet, wenn sie das Leben der Menschen grundlegend bestimmt (weswegen der Staat natürlich am besten so viel wie möglich regeln soll) – ich jedoch sehe das etwas anders.
Zur begrifflichen Klarstellung: Eine Abschaffung des Gewaltmonopols bedeutet nicht, dass der Staat überhaupt keine Gewalt mehr einsetzen kann. Es bedeutet lediglich, dass er nicht mehr das Monopol darauf hat. Es könnte (technisch gesehen) unter Umständen durchaus sinnvoll sein, Gewalt einzusetzen, beispielsweise um andere Gewalt zu bekämpfen. Hannah Arendt spricht da von der Verteidigung der Randbereiche des Politischen. Konkret wäre dies beispielsweise ein Krieg zur Verteidigung gegen einen Aggressor. Aber zwangsläufig muss das nicht passieren. Weiterhin: Eine Abschaffung des Gewaltmonopols bedeutet nicht gleichzeitig die Abschaffung der Exekutive. Letztendlich geht es darum, auf welcher Grundlage man einen Staat aufbaut: Ist der Staat politisch und steht er damit auf der Grundlage der Vereinigung seiner Bürger, die so Macht produzieren? Oder ist der Staat un-, ja, anti-politisch, weil er auf der Grundlage von Gewalt existiert, d.h. auf der Stärke eines Einzelnen (hier: einer einzelnen Institution) basiert, welche die Vielen zu lenken versucht?
Ich will kein einzelnes pädagogisches Konzept für alle verbindlich erklären, da ich das für anmaßend halte. Das Ziel meines Ansatzes ist es, das Bildungssystem nicht mehr auf Gewalt zu gründen, so dass die zwischenmenschliche Begegnung auf Augenhöhe möglich wird. Eine „gesamtheitliche Deckung“ wird sich, da bin ich mir sicher, von alleine einstellen, wenn sie denn wirklich gesamtheitlich gewünscht wird, da bedarf es keines Ukas von oben.
Konkret würde ich im größeren Zusammenhang, das heißt im Falle Deutschlands, den Staat auf seine Kernbereiche beschränken, die da sind: Schutz des Lebens und Schutz des Eigentums, so dass der Gesellschaft möglichst viel Raum gelassen wird, gesellschaftliche Fragen aus ihrer Mitte heraus zu beantworten und zu lösen.
Dazu gehört unter anderem die Aufhebung des „Sozialstaats“ in seiner heutigen Bedeutung zugunsten der Verwirklichung des „sozialen Staates“ wie er in Art. 20 GG festgesetzt ist (eine Umdeutung, die letztlich auf Adenauer zurückgeht und mit der er sich Wählerstimmen erkauft hat), so dass die Schwächeren der Gesellschaft als Menschen und nicht bloß als Rechnungsgrößen im Sinne von „Geber“ und „Empfänger“ wahrgenommen werden. Dazu gehört aber vor allem die Abschaffung der Schulpflicht hin zur Verwirklichung eines freien Bildungswesens. Einen Ansatz hierzu bildet das Konzept einer Bildungspflicht, die den Eltern so lange die freie Wahl der Unterrichtsmethode überlässt, wie der Schüler jährliche Tests anhand staatlich festgesetzter Standards besteht, womit gleichsam Art. 7 GG Genüge geleistet wird.
Das Waffenrecht ist – als direktes Korrelat zum staatlichen Gewaltmonopol – ein sehr heikles Thema; dennoch wäre ich dafür, zumindest diejenigen Einschränkungen wieder aufzuheben, die in den 1970er Jahren angesichts des RAF-Terrors eingeführt wurden und nun, spätestens seit der Auflösung der RAF 1998, obsolet geworden sind, weil die Bedrohung verschwunden ist und die Bedrohung durch den neuen Terrorismus andere Wege beschreitet und daher anderer Lösungswege bedarf.
Desweiteren bin ich für die Einführung einer Sunset-Klausel, die Legislativakten, welche nicht von Verfassungsrang sind, nur für eine bestimmte Dauer (meiner Meinung nach maximal zwei Legislaturperioden) Gültigkeit verleiht, so dass Gesetze nach einer bestimmten Frist auf ihren Sinn und Zweck geprüft und dann ggf. verlängert werden müssen oder automatisch aufgehoben sind.
Vom Föderalismus will ich hier nicht groß anfangen, ich werfe als Stichwort nur mal die Aufhebung der Liste für konkurrierende Gesetzgebung in den Raum (Art. 74 GG).
Entweder fällt ein Bereich in die Bundeskompetenz oder er fällt nicht hinein. Hat der Bund nichts damit zu schaffen, dann liegt die Kompetenzvermutung bei den Ländern. Ein ähnliches Prinzip fände ich auch auf Landesebene sinnvoll, d.h. dass die Kommunen größere Gestaltungskompetenzen erhalten und nicht bloß ausführende Verwaltungsorgane sind. Aber das muss natürlich in jedem Land einzeln durchgesetzt werden. Darüber hinaus sollte auch der Länderfinanzausgleich abgeschafft werden, der eine einzigartige Institution in der globalen Perspektive föderaler Staaten ist1 und letztendlich keinen föderalen, sondern einen unitarischen Bundesstaat bezeichnet.
- Wer sich dafür interessiert, dem sei GRIFFITHS, Ann [Hg.], Handbook of Federal Countries, 2005 [Forum of Federations], Montreal 2005, wärmstens ans Herz gelegt. ↩︎
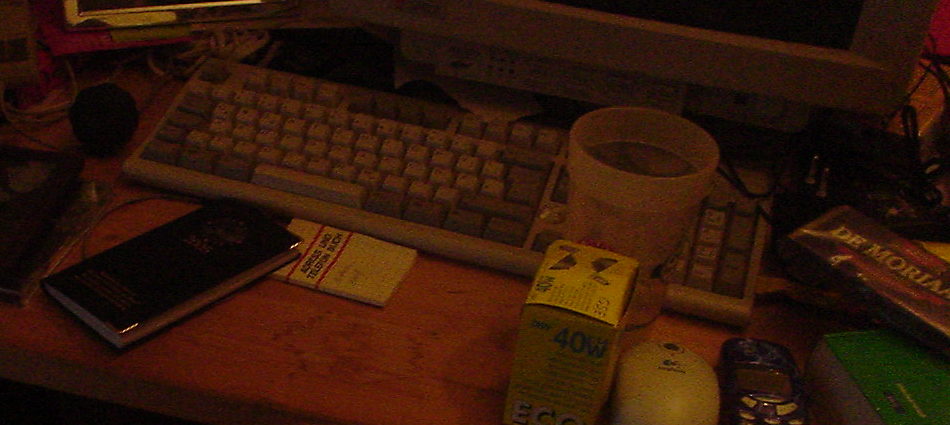
Schreibe den ersten Kommentar